Wir suchen immer neue Beiträge für unseren Blog – einen Call mit allen relevanten Informationen findet ihr hier!
Gefördert durch: BMFTR
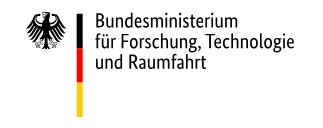
Krebs im Kindesalter – Datenverarbeitung in der medizinischen Forschung
Dass wir gerade bei der Internetnutzung Daten über uns preisgeben, sind wir inzwischen gewohnt. Viele dieser Daten erscheinen uns als harmlos, andere Arten von Daten würden dagegen die meisten wohl nicht ohne Weiteres in jeder Situation teilen wollen.
Zu diesen sensiblen Daten, deren Weitergabe oft mit großem Risiko verbunden ist, gehören etwa Gesundheitsdaten und genetische Daten. Diese Daten können Aufschluss über unsere Person sowie ggf. auch über Dritte, wie unsere Verwandten geben.
Allerdings müssen die eigenen Daten nicht immer ein Geheimnis sein, das man unbedingt für sich behalten muss. Wenn die eigenen Daten von einer anderen Person verarbeitet werden, muss diese dabei nicht zwangsläufig Übles im Schilde führen. Gesundheitsdaten werden etwa bereits verarbeitet, wenn Menschen ihren Hausärzt*innen die Frage beantworten, welche Beschwerden sie denn hätten. Die Antworten sind unabhängig von Digitalisierung – man denke an die ärztliche Schweigepflicht bereits unter anderem durch das Berufsgeheimnis der Heilberufe geschützt. Für die digitale, oft automatisierte, Verarbeitung von Daten gibt es ebenfalls eine Reihe von verbindlichen Regeln. Der bekannteste Text darunter ist für viele – spätestens seit dem Einzug der „Cookie-Banner“ beim Besuch einer Website – die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), und die sogenannte informierte Einwilligung ist vielleicht auch die bekannteste Möglichkeit, eine rechtmäßige Verarbeitung besonders geschützter Daten ausnahmsweise zu erlauben. Die Rechte, die den Betroffenen in Bezug auf ihre Daten zukommen, gehören zum Recht einer Person auf informationelle Selbstbestimmung.
Die jüngeren Entwicklungen bei der Anwendung maschinellen Lernens – das ist die derzeit wichtigste Technologierichtung, die man mit „Künstlicher Intelligenz“ verbindet – bieten gute Aussichten für die medizinische Forschung: darunter verbesserte Möglichkeiten etwa im Bereich der Genomanalyse, die für genetisch bedingte Leiden relevant ist. Nun bedürfen diese Technologien einer großen Menge Daten, und zwar besonders sensibler und schützenswerter Daten. Deshalb ist es in der wissenschaftlichen Praxis nicht ohne Weiteres möglich, diese Daten zu nutzen, wenngleich ein gesellschaftliches Interesse daran besteht, dass sich die Gesundheitsversorgung etwa durch die Erforschung neuer Therapiemöglichkeiten verbessert.
Am Thema der medizinischen Forschung zu Krebserkrankungen im Kindesalter soll in diesem Beitrag mehr Licht auf dieses Feld geworfen und ein Vorschlag zur Verbesserung der Situation eingebracht werden.
Eine Krebserkrankung wird oft mit hohem Alter und einem risikoreichen Lebensstil verbunden, doch trifft es leider auch Kinder. Eine der größten Erfolgsgeschichten in der Krebsforschung ist die Entwicklung von Therapien der akuten lymphatischen Leukämie, der häufigsten Krebserkrankung im Kindesalter. Besser als Krebs zu heilen wäre es, seinen Ausbruch bereits zu verhindern. Erfreulicherweise wird nicht bloß seit Mitte des letzten Jahrhunderts verstärkt in die Forschung zur Erkennung, Behandlung und Prävention von Krebs investiert. Die Europäische Union hat einen umfangreichen Plan zur Krebsbekämpfung gefasst, worin einige Milliarden Euro investiert werden, etwa um die Krebsforschung nicht nur in der Sache, sondern in ihrer Vernetzung zu fördern. So sollen bspw. im Rahmen des CraNE-Projekts ein Europäisches Netzwerk der nationalen Krebszentren oder im UNCAN-Projekt ein föderiertes Datenzentrum – also verteilt auf mehrere Orte – für die Krebsforschung entstehen. Mit den Programmen des EU4Health-Pakets und der Förderung durch die EU-Mission: Krebs werden weitere Anstrengungen unternommen. Die Vernetzung von Gesundheitsdaten ist auch das Anliegen des Europäischen Gesundheitsdatenraums (European Health Data Space – EHDS). Durch die Einrichtung des EHDS soll eine einheitliche digitale Gesundheitsdateninfrastruktur geschaffen werden, die den Menschen einerseits leichteren (vgl. Erwägungsgrund 9 EHDS-Verordnung) und transparenten (vgl. Erwgr. 16) Zugang zu ihren Gesundheitsdaten ermöglicht. Für die wissenschaftliche Forschung ist der EHDS vielversprechend, da die sogenannte Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, also die Weiterverarbeitung von bereits erhobenen Daten zu einem anderen als dem ursprünglichen Verarbeitungszweck, für die Forschung explizit unterstützt werden soll (vgl. Erwgr. 53), wenn die betroffene Person dem nicht widerspricht (vgl. Erwgr. 54). So können mehr relevante Daten aus dem ganzen Gebiet der Europäischen Union für die Forschung genutzt werden. Von Interesse ist unter anderem auch die Fruchtbarmachung der aktuellen Forschung und Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens gerade für bildgebende Verfahren. Zu nennen wären hier etwa das EUCAIM-Projekt oder das AI for Health Imaging-Netzwerk. Auch in Deutschland geht es zur Sache: 2019 wurde die Nationale Dekade gegen Krebs ausgerufen, in deren Rahmen eine Vielzahl von Projekten gefördert wird. Förderrichtlinien wie „Datenschätze gemeinsam heben“, „Medizinische Forschung braucht Daten“ oder „DataXperiment Erprobung innovativer Machbarkeits- und Anwendungsszenarien in der Onkologie“ unterstreichen ebenso wie die Arbeit der Medizininformatik-Initiative oder die von der Dietmar Hopp-Stiftung geförderte pädiatrische Krebsdatenportal-Initiative auch hier die Wichtigkeit und das Potential der Datennutzung in der Krebsforschung. Es besteht dadurch eine Chance zur Verbesserung der Behandlung bei seltenen Erkrankungen wie den Krebsleiden im Kindesalter.
In der Praxis wird weitgehend auf die ausdrückliche informierte Einwilligung der Betroffenen als Rechtsgrundlage der ausnahmsweisen Verarbeitung zu Forschungszwecken zurückgegriffen. In Anbetracht der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung – wie das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ebenfalls ein Grundrecht – ist der Weg über die Einwilligung jedoch nicht alternativlos. Denn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Forschungszwecke ist in der DSGVO erlaubt, und dies ist für die Gesetzgebung eine Konsequenz aus der Forschungsfreiheit: Vor dem Hintergrund der grundrechtlichen Forschungsfreiheit gemäß Art. 13 der EU-Grundrechtecharta (GRCh) und Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz (GG) und unter Einbezug des Erwägungsgrundes 159 der DSGVO, der insbesondere eine weite Auslegung des Forschungsbegriffs fordert, erlaubt Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DSGVO die Verarbeitung personenbezogener Daten – also insbesondere Gesundheitsdaten und genetischer Daten – für Zwecke wissenschaftlicher Forschung.
Hier ist zunächst zu bemerken, dass Forschungsinteressen und informationelle Selbstbestimmung keineswegs entgegengesetzt sein müssen, ihre Gegenüberstellung im Bilde eines scharfen schwarz weiß-Kontrasts nicht angemessen ist. Selbst wenn keine Möglichkeit eines unmittelbaren Nutzens etwa im Rahmen eines Forschungsprojekts zu einer neuartigen medizinischen Behandlungsmethode oder in der translationalen medizinischen Forschung, die klinische Praxis mit Forschung verbindet im Raum steht, können Patient*innen ein Interesse haben, die medizinische Forschung mit ihren Daten zu unterstützen, um zukünftiges Leid anderer zu mindern.
Auch die informierte Einwilligung ist nicht optimal: Man bräuchte eine ganze Menge Kraft und Zeit, um sich eine fundierte Meinung über das Für und Wider der Einwilligung bilden zu können und wirklich informiert zu sein. Dazu kommt der oft hohe Aufwand für ein Forschungsvorhaben, eine solche Informierung zu ermöglichen, besonders für die Betroffenen unter den erschwerten Bedingungen ihrer Erkrankungen oder auch eines kindlichen Alters.
Nun wird unter Verweis darauf, dass die weitere Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken unter den genannten Garantien (Art. 89 Abs. 1 DSGVO) vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken der Datenerhebung ist (gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b DSGVO), vertreten, dass im europäischen Recht die Forschungsfreiheit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gleichrangig sind.[*] Das bedeutet, dass nicht im Vorhinein schon dem einen mehr Gewicht als dem anderen beigemessen wird. Es ist also nicht so, dass die Forschung hier bessergestellt wäre und ein Einwand einer betroffenen Person unter Berufung auf informationelle Selbstbestimmung nicht ausreichte.
[*]: So etwa Weichert (Rn. 179 zu Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DSGVO in Kühling/Buchner: DSGVO BDSG, 4. Auflage 2024)
Bei der Anwendung des Datenschutzrechts fehlt häufig eine standardisierte Abwägung zwischen Schutz- und Verarbeitungsinteressen. Es ist daher zu überlegen, wie – ohne der Einzelfallgerechtigkeit Abbruch zu tun – in der besonderen Situation der Kinder den Herausforderungen einer fallbezogenen Abwägung besser begegnet werden könnte; insbesondere, wenn aus Gründen der Rechtsunsicherheit in der Praxis viele der von der Gesetzgebung vorgesehenen Möglichkeiten nicht standardisiert genutzt werden.
Wissenschaftliche Forschung ist vielfältig: Forschungsprojekte können sich in nahezu jeder Hinsicht bedeutend voneinander unterscheiden, weshalb etwa Fragen, wie rechtmäßige Datenverarbeitung umgesetzt werden kann, für den konkreten Einzelfall diskutiert und beantwortet werden müssen. Das heißt aber nicht, dass man in jedem einzelnen Forschungsprojekt mit allem jeweils von Neuem beginnen müsste, denn es gibt durchaus Ähnlichkeiten in bestimmten Forschungssituationen. Im hier angesprochenen Bereich der medizinischen Forschung zu Krebs im Kindesalter ergeben sich direkt zwei Besonderheiten, die dort immer vorkommen. Da es sich bei den datengebenden Menschen um Kinder handelt, lohnt es sich, die vorhandenen Kenntnisse im Umgang mit den besonderen Schutzinteressen der Kinder zu bündeln. Darunter könnte bspw. die Art und Weise der Einbindung von Vertreter*innen der Betroffenen, Besonderheiten in der Informationsvermittlung gegenüber sorgeberechtigten Personen und Kindern unterschiedlichen Alters und Reife o. Ä. fallen. Weiter handelt es sich in den möglichen Konstellationen stets um Krebsforschung, sodass sich auch hier anbietet, die Expertise zu konzentrieren, um die Besonderheiten dieses Forschungsbereichs, die regelmäßig oder häufig auftreten, wie etwa die Verarbeitung genetischer Daten, angemessen zu berücksichtigen, um auf verantwortliche Weise mehr Zeit und Mühe für die eigentliche Forschung frei und ihre häufig existenzielle Bedeutung bewusst zu machen.
Wichtig ist dabei ebenfalls eine Abstimmung mit den jeweiligen Landesdatenschutzbehörden, die an der Konzeption und Erarbeitung solcher standardisierenden Orientierungshilfen idealerweise mitwirken könnten, damit eine akzeptierte und einheitliche Praxis gemeinsam mit einer besseren Vernetzung von Ansprechpartner*innen für die Forschung erreicht werden kann. Auf diese Weise könnte ebenfalls eine nachhaltige Verbesserung und Vereinheitlichung der Rechtsanwendung befördert werden.
Für die Betroffenen selbst ist es einfacher, einen größeren Beitrag zur medizinischen Forschung zu leisten. Durch die Teilhabe über Betroffenenvertreter*innen an der Gestaltung der Orientierungshilfen kann auch das Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang mit den Daten für die medizinische Forschung gestärkt werden.
Dieser Beitrag ist im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „Datenschutzgerechte Nutzung großer Sprachmodelle im Gesundheitswesen – ILLUMINATION“ entstanden, FKZ: 16KIS2116
Links zu Krebsforschungsinitiativen
Plan zur Krebsbekämpfung (EU)
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_de
CraNE-Projekt
https://crane4health.eu
UNCAN-Projekt
https://uncan.eu
EU4Health-Paket
EU4Health – European Commission
EU Mission: Krebs
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes
and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/eu-mission-cancer_en
Europäischer Gesundheitsdatenraum
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_de
EUCAIM-Projekt
https://cancerimage.eu/
AI for Health Imaging-Netzwerk
https://ai4hi.net/
Nationale Dekade gegen Krebs
https://dekade-gegen-krebs.de
Medizininformatik-Initiative
https://www.medizininformatik-initiative.de/
pädiatrische Krebsdatenportal-Initiative
https://www.pedcanportal.eu/
Weitere Informationen zum Tema Krebs im Kindesalter finden Sie bspw. auf den folgenden Seiten
des Krebsinformationsdienstes bzw. der Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie
(GPOH):
https://www.krebsinformationsdienst.de/krebs-bei-kindern
https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/index_ger.html
Gesetzestexte Europa
Grundrechtecharta (GRCh)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
EHDS-Verordnung (EHDS-VO)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32025R0327
Gesetzestexte Deutschland
Grundgesetz (GG)
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – insbes. ärztliche Behandlung
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/BJNR209710017.html
Landesdatenschutzgesetze (LDSG)
https://dsgvo-gesetz.de/ldsg/
Gendiagnostikgesetz (GenDG) – insbes. medizinische Gendiagnotik bei Minderjährigen
https://www.gesetze-im-internet.de/gendg/BJNR252900009.html
Bundeskrebsregistergesetz (BKRG)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkrg/BJNR270700009.html
Über die Autoren
Timo Weiß studierte Philosophie, Mathematik und Psychologie in Bonn, Kyōto und Bochum. Er
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Molnár-Gábor an der Universität
Heidelberg, wo er im Rahmen des ILLUMINATION-Projekts zur Anwendung maschinellen Lernens in
der Medizin arbeitet.

Marc Nestor studierte Volkswirtschaftlehre/Economics (B.Sc., M.Sc.) mit dem Schwerpunkt Statistik und Verhaltensökonomik in Heidelberg. Er war zuvor an der Universität Heidelberg sowie bei verschiedenen Unternehmensberatungen in Weinheim und Mannheim beschäftigt und war zuletzt für die Verwaltung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften tätig. Seit 2022 ist er für den Bereich Networking und Communications am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Molnár-Gábor tätig.



